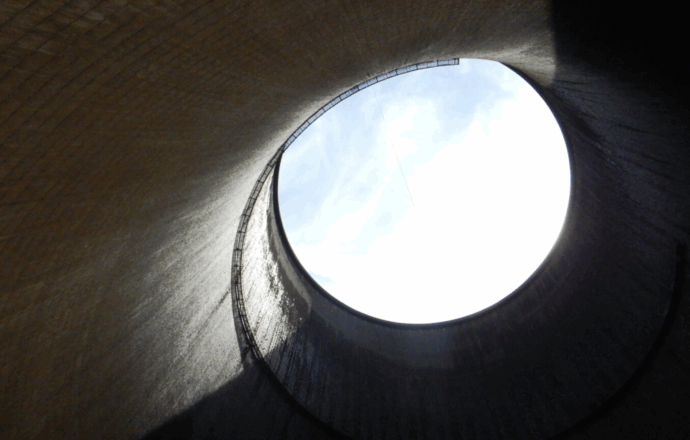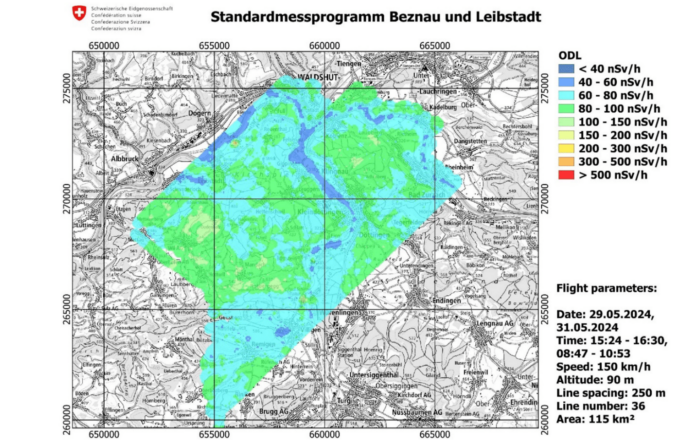Bild: Bei Siedewasserreaktoren wie in Leibstadt und Mühleberg führt ein zeitnahes Wiederanfahren dazu, dass kurzfristig erhöhte Mengen radioaktiver Gase an die Umwelt abgegeben werden.
Beim Normalbetrieb eines Kernkraftwerks entstehen radioaktive Gase und Schwebestoffe. Die meisten zerfallen bereits nach kurzer Zeit in nicht mehr radioaktive Stoffe.
Falls eine Betriebsstörung auftritt, aufgrund derer das Kernkraftwerk nicht mehr innerhalb vorgegebener Betriebsgrenzen betrieben werden kann, wird eine Reaktorschnellabschaltung ausgelöst. Damit wird die Wärmeproduktion schlagartig reduziert und die verbleibende Nachwärme wird über Betriebs- oder Sicherheitssysteme abgeführt.
Wenn die Ursache für die Reaktorschnellabschaltung rasch behoben werden kann, wird das Kernkraftwerk bereits kurze Zeit nach der Reaktorschnellabschaltung wieder angefahren. Bei Siedewasserreaktoren wie in Leibstadt und Mühleberg führt dies dazu, dass kurzfristig erhöhte Mengen radioaktiver Gase an die Umwelt abgegeben werden, weil ein grösseres Luftvolumen abgelassen werden muss. Im Leistungsbetrieb zerfallen diese Gase zum grössten Teil noch vor der kontrollierten Abgabe über den Kamin an die Umwelt. Für diese Abgabe gelten vom ENSI festgelegte Limiten.
Das grössere Luftvolumen entsteht, weil Luft aus dem Kondensator gepumpt werden muss, um darin einen Unterdruck zu erzeugen. Dieser Unterdruck dient im Normalbetrieb dazu, Dampf aus den Turbinen zu Wasser zu kondensieren.