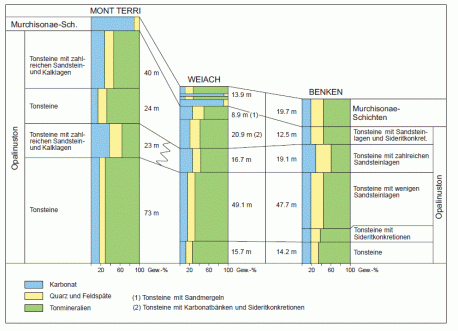a)
Die Frage der maximalen Tiefenlage eines HAA-Lagers haben das ENSI und ihre Experten (KNE und Ingenieurgeologie ETH Zürich) ausführlich überprüft und in ihren Expertenberichten beziehungsweise im Gutachten dokumentiert (Amann F., Löw S. (2009); ENSI 33/070; KNE (2010)). Die wesentliche Schlussfolgerung im Bericht Amann & Löw 2009 ist, dass mit eingeschränkten Sicherungsmitteln (Anker, Kopfschutz) die bautechnische Machbarkeit der HAA-Lagerstollen im intakten Opalinuston nur bis in eine Tiefe von 650 m unter Terrain erbracht ist. Für Tiefenlagen > 650 m bis 900 m ist ein vollflächiger Ausbau (z.B. Spritzbeton, Tübbings) notwendig. Für das HAA-Lagerkonzept hat die Nagra ein entsprechendes neues Ausbaukonzept vorgelegt (NAB 09-29). Das ENSI und die KNE beurteilen Tiefenlagen von bis zu maximal 900 m als bautechnisch machbar und sinnvoll (vgl. Fachsitzung des Technischen Forums Sicherheit vom 4.8.2010). Die sicherheitstechnischen Anforderungen bezüglich Schutzes vor flächenhafter Erosion, Dekompaktion und glazialer Tiefenerosion erfordern nach Ansicht des ENSI und der KNE keine Tiefenlagen grösser 900 m. Es bestehen daher keine entgegen gesetzten Anforderungen an die Tiefenlage. Das ENSI und die KNE möchten aber darauf hinweisen, dass in Etappe 2 SGT für Tiefen > 650 m für HAA-Lagerstollen sowohl bautechnische wie sicherheitstechnische Nachweise der neuen Ausbaukonzepte vorzulegen sind.
b)
Zwischen den felsmechanischen Kennwerten des Opalinustons im Mont Terri (vornehmlich aus der „Tonigen Fazies“) und den felsmechanischen Kennwerten ermittelt an Bohrkernen der Bohrung Benken bestehen signifikante Unterschiede. Als Beispiel sei die einaxiale Druckfestigkeit senkrecht zur Schieferung genannt, welche im Mont Terri bei rund 11.6 ±3.9 MPa und in der Bohrung Benken bei 30.3 ±6.6 MPa liegt. Letztere Kennwerte wurden für die bautechnische Beurteilung der HAA-Lagerstollen in den potentiellen Standortgebieten Benken, Nördlich Lägern und Jura Ost1 herangezogen.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen den felsmechanischen Kennwerten von Benken und Mont Terri ist zentral für die Beantwortung der Frage b und die Begründung der in Etappe 1 SGT verwendeten Kennwerte. Darum wird im Weiteren auf die wesentlichen Aspekte eingegangen, welche die Festigkeit des intakten Opalinustons beeinflussen.
Wesentliche Einflussfaktoren für die felsmechanischen Eigenschaften
Die felsmechanischen Eigenschaften von intaktem Opalinuston (das heisst nicht geklüftet oder tektonisch überprägt) wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren beeinflusst:
- Wassergehalt
- Diagenetischer Zement
- Tongehalt und Anordnung der Tonpartikel (z.B. Grad der Ansiotropie)
- Gehalt und Verteilung von sedimentären/diagenetischen Heterogenitäten (Quarzkörner, Bioklasten, Silt/Sandsteinlinsen, Sideritkonkretionen etc.)
Zusätzlich sind für die felsmechanischen Gebirgseigenschaften (diese werden hier nicht weiter behandelt) folgende Einflussfaktoren zu nennen:
- Klüftigkeit (Anzahl der Kluftfamilien, Abstand der Trennflächen zueinander)
- Geometrie, Durchtrennungsgrad und mechanische Eigenschaften der Trennflächen
Basierend auf verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen lässt sich für intakten Opalinuston belegen, dass besonders der Wassergehalt, der ebenso wie die Porosität und die Gesteinsdichte im engen Zusammenhang mit dem Konsolidationsgrad (Belastungsgeschichte) steht, als wesentlichster Faktor der Festigkeit zu betrachten ist (Figur 46-1).
[caption id="attachment_13461" align="alignnone" width="458"]

Figur 46-1: Wassergehalt gegenüber der einaxialen Druckfestigkeit am Beispiel von Tonsteinen. Die Ziffern 3 und 5 zeigen die Variabilität der Festigkeiten und des Wassergehalts für den Opalinuston im Mont Terri sowie den Opalinuston in Benken (Quelle: NTB 02-03).Wassergehalts für den Opalinuston im Mont Terri sowie den Opalinuston in Benken (Quelle: NTB 02-03).[/caption]
Sedimentologische Aspekte
In der Bohrung Benken (Abschnitt Opalinuston) konnten durch detaillierte sedimentlogische und mineralogische Untersuchungen nachfolgende unterscheidbare Bereiche ausgeschieden werden (in Klammern ist vermerkt, welche Institution felsmechanische und mineralogische Untersuchungen vorgenommen hat; die unterstrichene Einheit liegt in etwa in der Mitte des Opalinustons):
- Tonstein mit Sandsteinlagen und Sideritkonkretionen
- Tonstein mit zahlreichen Sandsteinlagen (Laborversuche MESY)
- Tonstein mit wenig Sandsteinlagen (Laborversuche EPFL, MESY)
- Tonstein mit Sideritkonkretionen (Laborversuche MESY)
- Tonstein (Laborversuche MESY)
Eine regionaler Vergleich unter zur Hilfenahme der sogenannten „Dachbankzyklen“ zeigt, dass der Opalinuston in der Bohrung Weiach (Standort Nördlich Lägern) und der Bohrung Riniken (Standort Jura Ost) ähnlich wie in der Bohrung Benken ausgebildet ist. Allerdings ist in Weiach der Quarz- und Karbonatgehalt etwas tiefer als in Benken. Generell ist festzustellen, dass die mineralogische Zusammensetzung über weite Distanzen extrapolierbar ist, in der quantitativen Zusammensetzung jedoch Unterschiede feststellbar sind. Der Tongehalt nimmt beispielsweise gegen Westen tendenziell zu, der Quarz- und Karbonatgehalt hingegen ab (Figur 46-2).
Die sogenannte „sandig-kalkige Fazies“ wie sie im Mont Terri vorzufinden ist, ist in den Nordschweizer Bohrungen nicht zu finden. Dies steht im Zusammenhang mit differentiellen Hebungsraten des ehemaligen Ablagerungsraum (Becken), was zu einer ausgeprägten Morphologie und zu abgetrennten Faziesräumen führte. Dennoch entspricht die „tonige Fazies“ im Mont Terri mineralogisch in etwa den drei unteren, tonreicheren Gliedern der Bohrung Benken (Figur 46-2). Insgesamt ist der Tonanteil im Mont Terri jedoch deutlich grösser.
[caption id="attachment_13462" align="alignnone" width="458"]
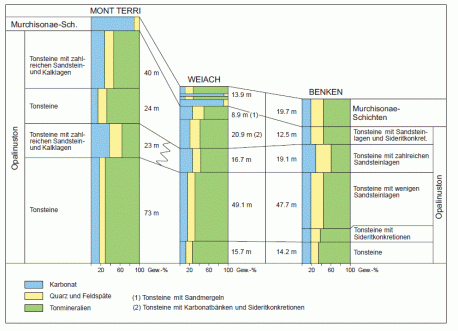
Figur 46-2: Korrelationen zwischen den unterscheidbaren Bereichen im Opalinuston der Bohrung Benken über Weiach zum Mont Terri. Die „tonige Fazies“ im Mont Terri entspricht rein mineralogisch den unteren drei Einheiten der Bohrung Benken (Quelle: NTB 02-03).[/caption]
Versenkungsgeschichte
Bei der Beurteilung der felsmechanischen Kenngrössen des Opalinustons ist besonders der Wassergehalt zu nennen (
Figur 46-1). Regionale Unterschiede im Wassergehalt stehen im Zusammenhang mit der Porosität und Dichte, welche signifikant von der ehemalige Versenkung oder Vorbelastung (Konsolidationsgrad) des Tongesteins abhängen. Innerhalb der Schweiz lässt sich entlang eines E-W-Schnittes (
Figur 46-3) beginnend in Herdern (Osten) zum Mont Terri (Westen) eine abnehmende maximale Versenkungstiefe des Opalinustons feststellen:
- rund 2850 m Herdern
- rund 1700 m Benken
- rund 1650 m Weiach
- rund 1550 m Riniken
- rund 1000 m Mont Terri
Die maximale Versenkungstiefe von 2150 m, welche in Schafisheim ermittelt wurde, zeigt die generelle Zunahme der Versenkungstiefe des Opalinustons gegen Süden infolge der zunehmenden Auflagerung durch Molasse. Als Folge der unterschiedlichen maximalen Versenkungstiefe nimmt die Porosität von Osten nach Westen deutlich zu (Bodenseegebiet rund 4%; Zürich Nordost
2 rund 7-12 %; Mont Terri 14-18 %), während die Gesteinsdichte und die Durchschallungsgeschwindigkeiten abnehmen.
Als Wesentlich zu betrachten ist die vergleichbare maximale Versenkungstiefe in Weiach, Riniken und Benken, die auf eine ähnliche Porosität, Gesteinsdichte und Wassergehalt schliessen lässt. Da sich die mineralogische Zusammensetzung zwischen den Bohrungen sowohl qualitativ als auch quantitativ wenig verändert, ist auch bei den felsmechanischen Kenngrössen von nur geringen Unterschieden auszugehen.
[caption id="attachment_13463" align="alignnone" width="458"]

Figur 46-3: Lage der Bohrungen Herdern, Benken (BE), Weiach (WE), Riniken (RI) und Schafisheim (SH) sowie der in Etappe 1 SGT ausgeschiedenen, potentiellen HAA- Opalinuston Standortgebieten Zürich Nordost, Nörlich Lägern und Jura Ost.[/caption]
Fazit (Antwort)
Für den momentanen Projektstand (Etappe 1 SGT) erachten ENSI und KNE die Übertragung der felsmechanischen Kennwerte des Opalinustons (intakter Fels) von Benken für die bautechnischen Beurteilung der potentiellen HAA-Opalinuston Standortgebiete als plausibel (vergleichbare Vorbelastung). Die vom Felslabor Mont Terri („Tonige Fazies Opalinuston“) ermittelten Kennwerte erachten ENSI & KNE als nicht übertragbar. Eine regionale Variabilität der Kennwerte des intakten Opalinustons kann aufgrund des in der Bohrung Weiach festgestellten tieferen Quarz- und Karbonatgehaltes nicht ausgeschlossen werden und erfordert weiterführende, lokale Untersuchungen (kommende Phasen).
c)
Die aufgeworfenen Fragen zur Bautechnik in Etappe 1 SGT und die Überprüfung durch das ENSI und seine Experten (ETH, KNE) haben bereits zu einer Änderung beziehungsweise Ergänzung des HAA-Lagerkonzepts geführt (Ausbau der HAA-Lagerstollen im Opalinuston für Tiefen > 650 m mit vollflächige Stützmitteln).
Die Realisierung eines geologischen Tiefenlagers ist ein schrittweiser Prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt (drei Etappen SGT, Rahmenbewilligungsverfahren, Bau des Felslabors zur grossräumigen Charakterisierung des Wirtgesteins und Bestätigung der Gesteinseigenschaften → Baubewilligungsverfahren, Betriebsbewilligungsverfahren, etc.). Bei jedem Schritt sind die Lagerkonzepte nach Stand von Wissenschaft und Technik zu vertiefen und weiter zu konkretisieren (siehe
KEG/
KEV, Richtlinie
ENSI-G03). Gemäss den behördlichen Vorgaben in der Richtlinie
ENSI-G03 sind bei jedem Schritt der Realisierung für jede sicherheitsrelevante Entscheidung verschiedene Alternativen und ihre Bedeutung für die Langzeitsicherheit aufzuzeigen. Dabei ist ein für die Sicherheit günstiger Entscheid zu treffen. Dieses Optimierungsverfahren ist vom Projektanten zu dokumentieren. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass die Sicherheit in diesem langen schrittweisen Prozess der Lagerrealisierung stets oberste Priorität hat und dem jeweiligen Stand von Wissenschaft und Technik Rechnung trägt.
Referenzen
Amann F., Löw S. (2009): Vorschlag geologischer Standortgebiete für das SMA- und das HAA-Lager: Beurteilung und Anwendung der bautechnischen Auswahlkriterien, Expertenbericht ENSI 33/065, ETH, Ingenieurgeologie, Zürich.
ENSI 33/070: Sicherheitstechnisches Gutachten zum Vorschlag geologischer Standortgebiete, Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 1, Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat, Brugg, 2010.
KNE (2010): Sachplan Geologische Tiefenlager, Etappe 1 – Stellungnahme der KNE zur Sicherheit und bautechnischen Machbarkeit der vorgeschlagenen Standortgebiete, Expertenbericht Kommission Nukleare Entsorgung, Brugg.
KNS (2010): Stellungnahme zum sicherheitstechnischen Gutachten des ENSI zum Vorschlag geologischer Standortgebiete, KNS 23/219, Eidgenössische Kommission für nukleare Sicherheit, Brugg
09-29: Sachplan geologische Tiefenlager, Etappe 1: Fragen des ENSI und seiner Experten und zugehörige Antworten der Nagra, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra Arbeitsbericht, Wettingen, 2010.
NTB 02-03: Projekt Opalinuston: Synthese der geowissenschaftlichen Untersuchungsergebnisse – Entsorgungsnachweis für abgebrannte Brennelemente; verglaste hochaktive sowie langlebige mittelaktive Abfälle, Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, Nagra Technischer Bericht, Wettingen, 2002.
1 Auf Wunsch der Standortregion wurde das Standortgebiet Bözberg in Jura Ost umbenannt.
2 Auf Wunsch der Standortregion wurde das Standortgebiet Zürcher Weinland in Zürich Nordost umbenannt.